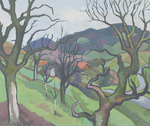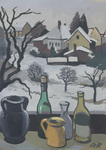Landschaften
Bald war bei ihm eine beginnende Zusammenfassung der Formen, zunächst im Hintergrund, zu erkennen. Dieser Prozess der Reduzierung setzte um 1965 ein, nachdem er sich in den Landschaften der 40er Jahre schon angedeutet hatte, und gipfelte in den Landschaften der 80er Jahre. Seine Motive bei den Landschaften waren meist Felder und Hügel, Dorfansichten und enge Gassen mit verschachtelten Häusern, einsame Gehöfte und Häfen mit Schiffen. Er malte im Süden in Frankreich und Spanien, als auch in Karlsruhe, am Rhein und im Schwarzwald. Es ist ein Verzicht auf Details und eine Zusammenfassung der Bildgegenstände zu Farbflächen mit Konturen zu erkennen. Es überwiegen große Formen und Flächen, die durch eine überschneidende Anordnung in ein räumliches Bildgefüge gebracht worden sind. Anders als bei Cézanne sind die Flächen mit schwarzen Umrissen eingefasst, was ein weiteres bestimmendes Merkmal in den Bildern von Rieger ab Mitte der 70er Jahre ist. Durch die Konturen erfahren die Formen Geschlossenheit, fast Kulissenhaftigkeit.
Es ist auch eine Verbindung zwischen der Malerei Riegers und seinen Zeichnungen herzustellen. Die weißen Flächen in den Zeichnungen entsprechen den großflächig modellierten in den Bildern. Bei seinem Spätwerk werden die Konturlinien in Riegers Bildern dicker und fassen die zu einfachen Farbflächen reduzierten Bildgegenstände zusammen, so dass jetzt festere und geschlossenere Formen, meist großflächig die Darstellung bestimmen. Große Formen sind bildbestimmend, meist im Vordergrund und flächig ausgestaltet, aneinander oder hintereinander gesetzt. Es ist eine Reduzierung der Bildgegenstände auf die Form und in der Farbe erfolgt.
Diese Darstellungsweise erinnert an die Fauves, einer Bewegung, die sich in Frankreich zwischen 1896 und 1906 entwickelte. Deren Vertreter Henri Matisse, Albert Marquet und André Derain, die auch Paul Cézanne als Vorbild hatten, vernachlässigten in ihren Bildern die Plastizität und die Raumwirkung ebenso wie sie das Bildganze mit nebeneinerdesetzten großen Flächen gestalteten. Der Bildraum ist flächig durch die Reduzierung von drei auf zwei Bildebenen, was bei Albert Rieger auch durch das Heranrücken des Hintergrunds und der Anordnung von großen Formen im Vordergrund verwirklicht wird. Eine Verflachung des Bildraums wird deutlich.
Für ihn war es am wichtigsten, mit wenigen Mitteln ein Stück Umgebung einzufangen und sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Natur mit Hilfe von großen Formen umfassend wiederzugeben.
Dabei diente die Zeichnung lediglich als Gerüst und stellte die Farbe sein Ausdrucksmittel dar. Albert Riegers Malerei blieb im Gegensatz zu Matisses Werken immer realistisch. Er vollzog den Übergang vom Bildraum zur Bildfläche und von der Plastizität zur Flächigkeit der Bildelemente nicht in aller Konsequenz. Die Natur wurde vereinfacht, indem durch Linien zusammengehaltene, die Farbe einschließende Formen aneinanderstoßen und Überschneidungen den Bildraum gestalten. Das Motiv wurde vom Bildobjekt zum Element aus Farbe.
Zusammenfassend äußerte sich Albert Riegers Stil der 80er Jahre in der Verringerung des Bildausschnitts, wordurch die Motive näher an den Betrachter heranrückten. Außerdem wurden sie in großen Formen mit dicken schwarzen Umrissen und ohne Einzelheiten wiedergegeben, meistens gemalt mit dicken Farbstrichen. Gebilde im Hintergrund, z.B. Bäume und Gebüsch, wurden größer mittels abgerundeter Formen dargestellt. Sie drängten dadurch mehr in den Bildmittelgrund und verringerten somit die Bildtiefe.
Albert Rieger wurde allgemein vom Expressionismus und speziell von den Fauves zu dieser Darstellungsweise und zu der Verwendung zusammenfassender Umrisse angeregt, nachdem sich deren Impulse für ihn seit den 60er Jahren verstärkt hatten. Seine bisherigen Erfahrungen und Einlfüsse sind zu einem für ihn markanten Stil zusammengeflossen.